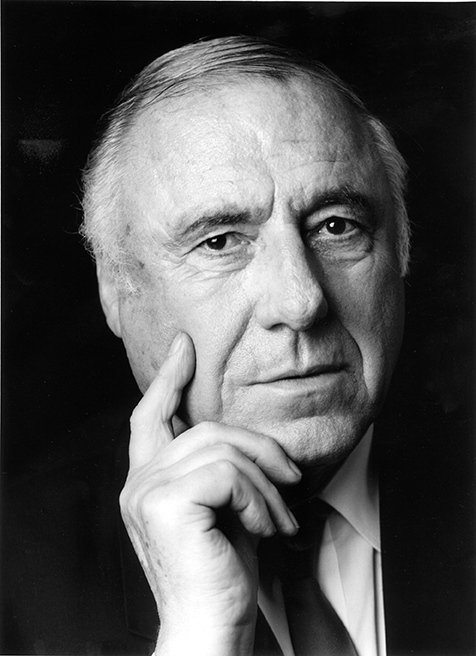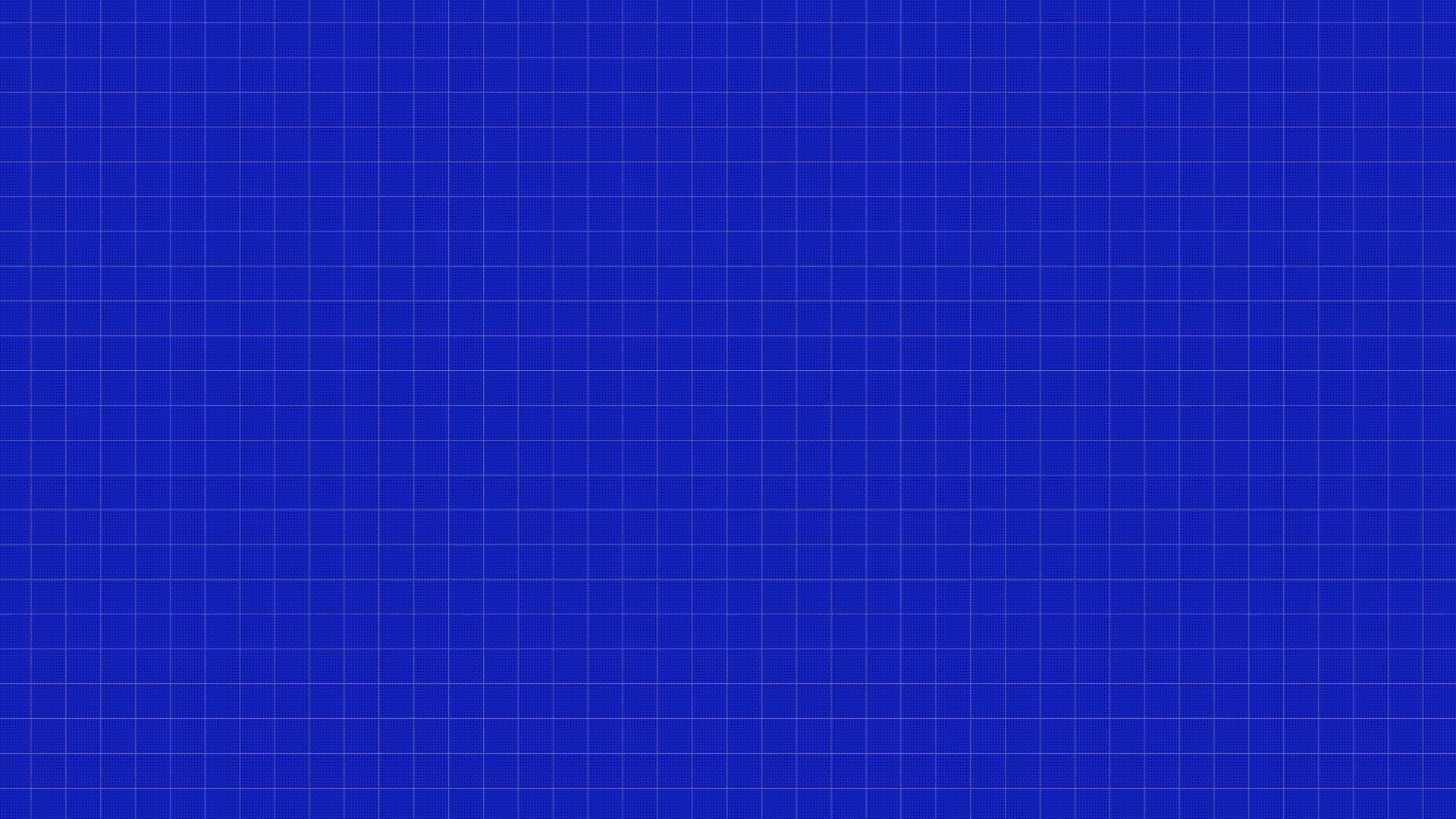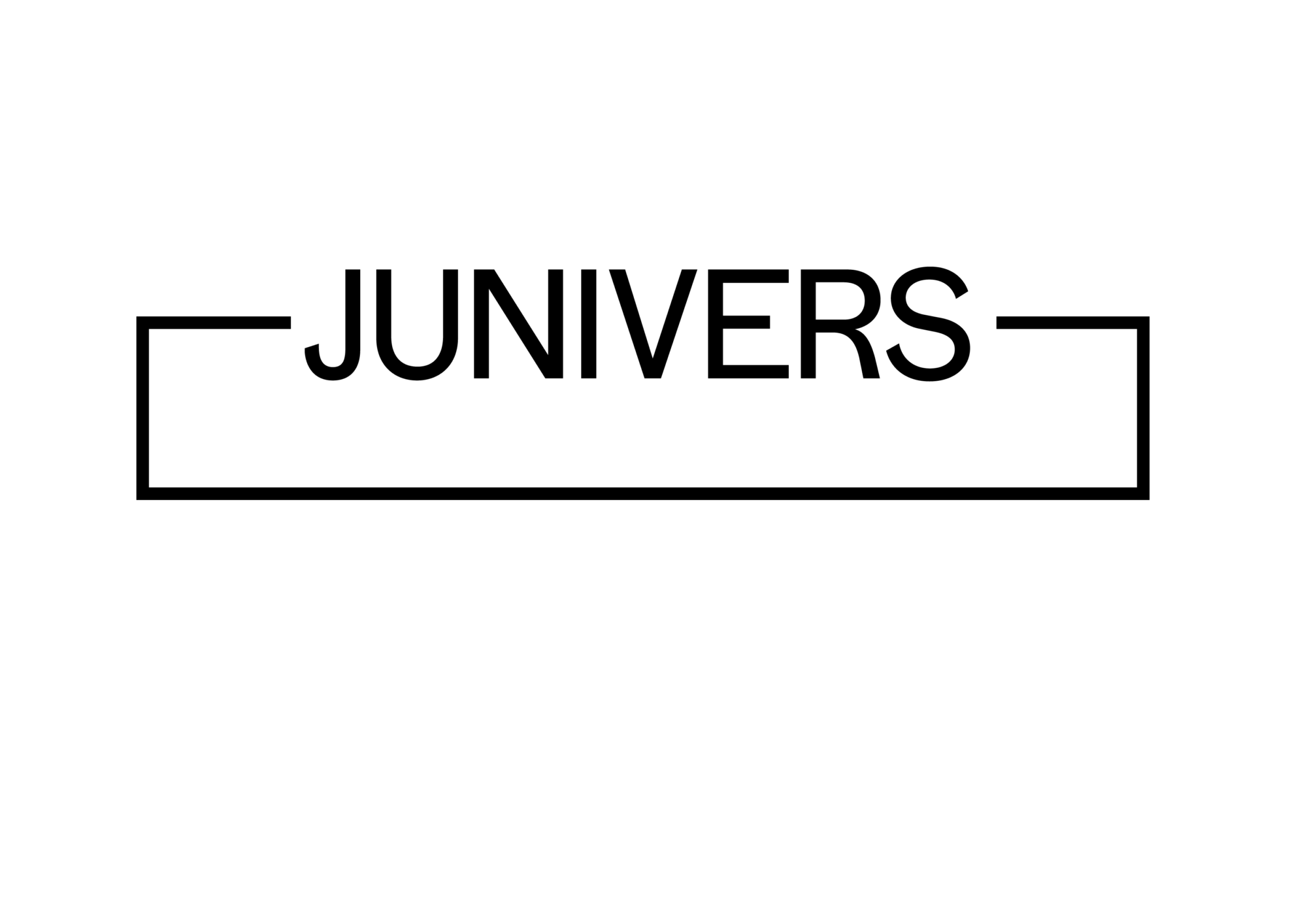Ákos Szolcsányi: »2021/1 – 2023/2«
2021/1 – 2023/2
Aus dem Ungarischen von Tünde Malomvölgyi
2021/1
Natürlich kann man eine Zivilisation, eine Religion, erst recht eine weitentfernte Galaxie auf dem Leitprinzip gründen Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen, Kamera läuft, wir haben nur ein Leben, es gibt keine Generalprobe, und das stimmt ja auch, oder zumindest funktioniert dieser Ansatz. Aber vielleicht wäre sein Funktionieren nicht so wichtig, stünde er nicht im Widerspruch zu jenem Schlupfwinkel der menschlichen Seele, in dem eine dicke, eingerollte, selbstverliebte Katze auf alles scheißt, so wie man es nur im Winter in der eigenen, geheizten Wohnung tun kann.
Wir versuchen die Dinge zu besprechen und gemeinsam weiterzumachen. Überhaupt mag ich es, Dinge zu versuchen. In diesem Fall besonders, wir haben ja nichts zu verlieren – was noch verlorengehen könnte, ist für uns beide zu kostbar. Es kann uns höchstens gelingen. Über eine Woche höre ich mir abends an, was ich alles verkackt, wie viel und welchen Schmerz ich verursacht habe und ich würde sagen, ich bin mir nicht untreu geworden, ich sage ihr, was ich einsehe und was ich anders sehe, wir sind wohlerzogen, bürgerlich. Irgendwann komme ich an die Reihe, ich spreche anderthalb Stunden, und damit endet auch gewissermaßen das Versuchen, denn um zu beleuchten, warum es in unserer Beziehung mir gar nicht zusteht, verletzt zu sein, müsste ich die Fäden bis zu unserem Kennenlernen 2005 entwirren, aber im Kontext von Corona, Liebhaber und Kind, zwischen zwei Nachtschichten gibt es dafür keinen Raum.
Sie ist wütend und kränkend, dann traurig. Mit ungewöhnlichen, großen Gesten, ich halte sie für ehrlich, aber es ist auch egal, wofür ich sie halte. Ich bin weder wütend noch kränkend oder traurig, betrachte sie wie ein Sterbender die letzte Stromabrechnung, in der ihm zu viel berechnet wurde und der die Mitteilung zunächst automatisch aufnimmt, dann aber gründlicher darüber nachdenken will, bis er von der Erkenntnis, wie von einem Verbrecher, überfallen wird: Das betrifft mich nicht mehr, und diese Erleichterung bringt ihn um.
Wir haben zu Weihnachten ein Spiel gekauft, in dem man zusammenarbeiten muss. Die Figuren sollen auf einer Brücke, die von sechs schmelzenden Eisblöcken getragen wird, von einer Eisscholle zur nächsten gelangen. Wir würfeln abwechselnd, ziehen mit einer Figur unserer Wahl, und am Ende gewinnen wir alle oder wir verlieren alle. Ein hervorragender Dämpfer für jede Familie, die vor der Scheidung steht. Gleichzeitig birgt das Spiel auch pikante Freuden, das Kind findet nämlich in den Figuren die Entsprechung seiner Familienmitglieder, wodurch sich die dämlichsten zutreffenden Aufstellungen ergeben. Als Erstes bringen wir immer das Kind hinüber, und so kommt es oft vor, dass Kind und Mama schon im Iglu sind, während Papa noch auf der Brücke steht, die nur noch von einem einzigen Eisblock getragen wird, und Mama ist an der Reihe mit Würfeln. Oder Papa und Kind sind schon im Iglu, während Mama auf der Brücke steht, die nur noch von einem einzigen Eisblock getragen wird, und Papa ist an der Reihe mit Würfeln. Wir nutzen die Situation nicht aus. Seine eigene Entsprechung findet das Kind ohnehin im Eisbären, der im Notfall ins Wasser springt, um den Fuchs oder den Hasen herauszuziehen.
Wäre es ein Wahlprogramm, würde ich es so zusammenfassen: Wir arbeiten einzeln zusammen. Aber der Teufel, der Engel, alles steckt in der Praxis. Zum Beispiel, dass sie diejenige ist, die auszieht. Sie verdient besser, also wird sie leichter eine Wohnung finden. Genauso logisch wäre: Sie verdient besser, also bleibt sie auf den siebzig Quadratmetern in der Gartenstadt, aber das Diktat der gesellschaftlichen Logik schreibt uns das erste Argument vor. Um sich die Wohnungssuche zu erleichtern, kauft sie sich ein Auto. Damit sie pendeln kann, falls sie nur weit entfernt eine neue Bleibe finden sollte. Mit frischer Nostalgie denke ich daran zurück, dass eine der Bruchlinien zwischen uns entlang der Frage verlief, warum ich mich denn so an das Auto klammere, wenn ich es weder mag noch Ahnung davon habe, wir brauchen es ja gar nicht und es verschluckt nur Geld, warum ich es nicht zu Hause verkauft habe, dazu habe sie ja schon damals geraten, aber vergeblich. Und siehe da, Ebbe und Flut der Zeiten haben die Wahrheit unter mein Vehikel gespült, es ist schon nicht schlecht, siebenhundert Kilogramm Eisen zu besitzen, in die man sich einfach hineinsetzen kann. Sie vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Siehst du, meine Liebe, auch dein Singledasein fängt so an, du musst mir auch nicht recht geben, aber es wäre echt schön, wenn du zumindest versuchen würdest, mich zu verstehen. Ja, wir hätten es zu Hause verkaufen sollen. Außerdem fährst du auch nicht besser als ich, du hasst es sogar, und überhaupt, wie ist nochmal der Plan, dass ihr an Kitatagen um halb fünf aufstehen wollt, weil ihr es so eilig habt, als würde euch jemand mit einer Axt verfolgen? Oho, was hab ich denn jetzt schon wieder gesagt? Sag schon. Dann sag’s eben nicht.
So etwas in der Art würde ich ihr sagen, aber das Spiel, dass ich ihr etwas sage, nur weil es mir wichtig ist oder gar grundsätzlich wahr, spielen wir nicht mehr. Ich sage nur noch Dinge, durch die alles leichter wird, in erster Linie für das Kind und in zweiter Linie für mich. Dann kauf doch eben eins. Siehst du schon das Ziel, lauf unbeschwert, [1] oder was weiß ich. Das Kind soll aber nicht mitfahren, solange du die Strecke nicht routinemäßig draufhast. Und vergiss nicht, deinen Organspendeausweis immer dabeizuhaben.
[1] Anspielung auf ein Gedicht von Endre Ady (»Új s új lovat« / »Immer ein neues Pferd«), übersetzt von Heinz Kahlau.
2023/2
Meine kostbaren Salben wirken lindernd auf deiner brennenden Haut. Darum, auch darum lieben mich die Mädchen nicht, weil mir keines von ihnen wichtiger sein kann als du, und wie ich ihnen das sagen soll, weiß ich nicht. Zieh mich nicht her hinter dir, laufe, so schnell du kannst! Ich bin mittleren Alters und gar lieblich, ihr Töchter Berlins, wie ein Regenbogen auf Altöl, wie ein Lichtstrahl in den Zwischenräumen zerbrochener Zaunlatten. Meinen eigenen Weinberg behüte ich, denn du isst von den Trauben, wenn es mir gelingt, sie zu behüten. Wenn ich dich, meine Tochter, mit anderen Mädchen vergleiche, bist du die richtige von allen möglichen Antworten im Quiz, du bist der keimende Samen und die edle Frucht unter den Bäumen und Blättern, bist die rote Kugel unter den vertauschten Hütchen. Unsere Wände sind weiß.
Du hustest mir ins Gesicht und steckst mir den Finger in die Nase; stärke mich mit einer geruhsamen Nacht, denn ich bin krank von deiner Krankheit. Siehe, der Winter ist herbeigekommen, es regnet, die Blumen zeigen sich nirgends auf dem Lande, der Wecker klingelt im Dunkeln, die Dunkelheit steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster, späht hinter der gewölbten Deckung des Vorhangs, lass uns singen, gerade weil die Zeit zum Singen noch nicht gekommen ist, lass uns singen, damit sie kommt, lass uns singen, wenn sie gekommen sein wird.
Des Nachts in meinem Hause schrecke ich auf und weiß nicht wo du bist, und bis ich es begreife, weiß ich auch nicht, wo ich bin. Da du nicht bei mir bist, will ich aufstehen und die Stadt durchstreifen, die Gassen und Straßen, will sie suchen, die meine zurückgelassene Seele liebt, ich suche, aber finde sie nicht.
Siehe, meine Tochter, du bist schön, deine Augen sind wie Laser und deine Hände senden alles durchdringende Lichtstrahlen. Deine Schritte sind Dinoschritte und dein Biss verwandelt mich in einen Zombi; sitzt du auf meinen Schultern, fliegst du in Wirklichkeit zum Himmel empor. Wieherst du, bist du ein Einhorn, ziehst du am Bändchen meines Traininganzugs, verwandele ich mich in ein Ross. Lachst du über mich, bin ich witzig, und wenn dich sechzig starke Räuber überfallen, nehme ich es mit sechzig starken Räubern auf. Du hast mein Herz geheilt, meine Schwester, meine Tochter. Hast du Fieber, nehme ich es dir wie ein Zauberer ab, möge meine Körpertemperatur um einen Grad steigen, wenn dadurch deine auch nur um einen halben Grad sinkt. Warum ich ihn denn so anschaue und ob ich betrunken sei, rügt mich der Herr inmitten seiner Tabellen und Kurven, während ich vom Fieberthermometer die Creme abwische.
Meine Tochter, du gehst mit deiner Mutter weg und lässt mich in der Welt zurück. Ich gewinne aus ihr Schokolade, Chips und duftende Cola, fresse alles, wie Brandenburger Schweine, und schaue dabei blutrünstige, traurige und langweilige Filme. Ich lese bereits veröffentlichte und künftige Bücher, die in Druckereien gedruckten stelle ich mir wieder als Manuskript vor, die nur virtuell existierenden in der Hand der sich sonnenden Jugend. Ich spreche mit Frauen und Männern über all das, worüber ich mit dir nicht reden kann, in Sprachen, die du noch nicht verstehst, wir trinken Wein, der dickflüssig ist wie Rohrreiniger, und der unsere Leere ebenso trügerisch zu füllen scheint. Ich putze, damit die Fliesen sauber sind und die Badewanne nach Chlor riecht, wenn du zu mir zurückkehrst.
Unsere Wörter gleichen einer Herde Schafe, alle haben sie Zwillinge und keins von ihnen ist unfruchtbar. Unsere Witze sind zweisprachig, in der einen Sprache werden Bohrmaschinen, in der anderen verpfuschte Leben erläutert – das Niveau wird uns nachgesehen –, unsere klirrendste Kälte ist im Vergleich zu ihrer die von gebrauchtem Badewasser. Bevor wir einen Streit beginnen, fragen wir uns mit Blicken, ob wir das wirklich wollen und entfachen ihn erst, wenn wir ihn wirklich wollen.
Ich bringe dir Bücher, meine Tochter, und verstumme vor deinen Freunden, denn meine Wissenschaften sind zwar zahlreich und interessant, aber meine Deutschkenntnisse peinlich. Mögen Zoltán Latinovits, Hobó und Attila József für dich Hanswürste eines Laienstickereivereins sein, die jegliches Gefühl für die Realität verloren haben; dein Vater wird Freudentränen vergießen, wenn du anstatt prunkvoller aber hinterwäldlerischer, banaler Lügen in dein eigenes Leben hineinwachsen kannst, allmählich, wie es sich für einen Menschen ziemt. Möge der Herr von unserem Hause fernhalten denjenigen, der dich zum Wunderkind erziehen, dir eine Berufung aufzwingen oder Verantwortung aufbürden wollte, und ihn durch Technoclubs in Berlin-Mitte und in anarchosyndikalistischen Wohnprojekten umherirren lassen, bis er dessen überdrüssig nach Hause zurückkehrt, wo man an Ankünfte glaubt und falsche Propheten verehrt.
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Peinigt man dich, soll ich gebrochen werden wie ein Siegel, möge ich wie eine Mauer sein, die Frieden findet, auch wenn sie zerstört wird. Aber zuvörderst: Mögest du niemals gepeinigt und möge ich niemals zerstört werden.
Ákos Szolcsányi, geboren 1984, ist Lyriker, Schriftsteller, Service Delivery Specialist und Übersetzer. Meine ersten Gedichte wurden auf die Oberfläche einer Schulbank geschrieben, über die Dummheit eines Mitschülers, ungefähr acht Monate nach dem Tod meiner Mutter. Kein Zusammenhang, dachte ich. Anschließend bin ich in die Hauptstadt Ungarns umgezogen, um Spanisch zu lernen, aber dort ist auch vieles andere geschehen. U. a. wurde ich überfallen und ein bisschen später an einer Uni zugelassen. Noch einmal dachte ich, kein Zusammenhang. In 2017 bin ich Vater und Doktor der Hispanistik geworden. Noch mal, kein Zusammenhang. Seit 2019 wohne ich in Berlin, bin auf der Suche nach Zusammenhängen (mit wenigem Erfolg) und lerne Deutsch. Wie die Hauptfigur einer Lebensversicherungswerbung geht es mir immer besser.