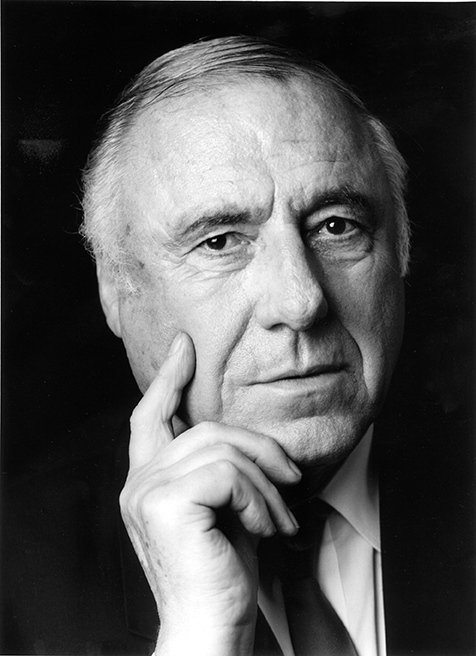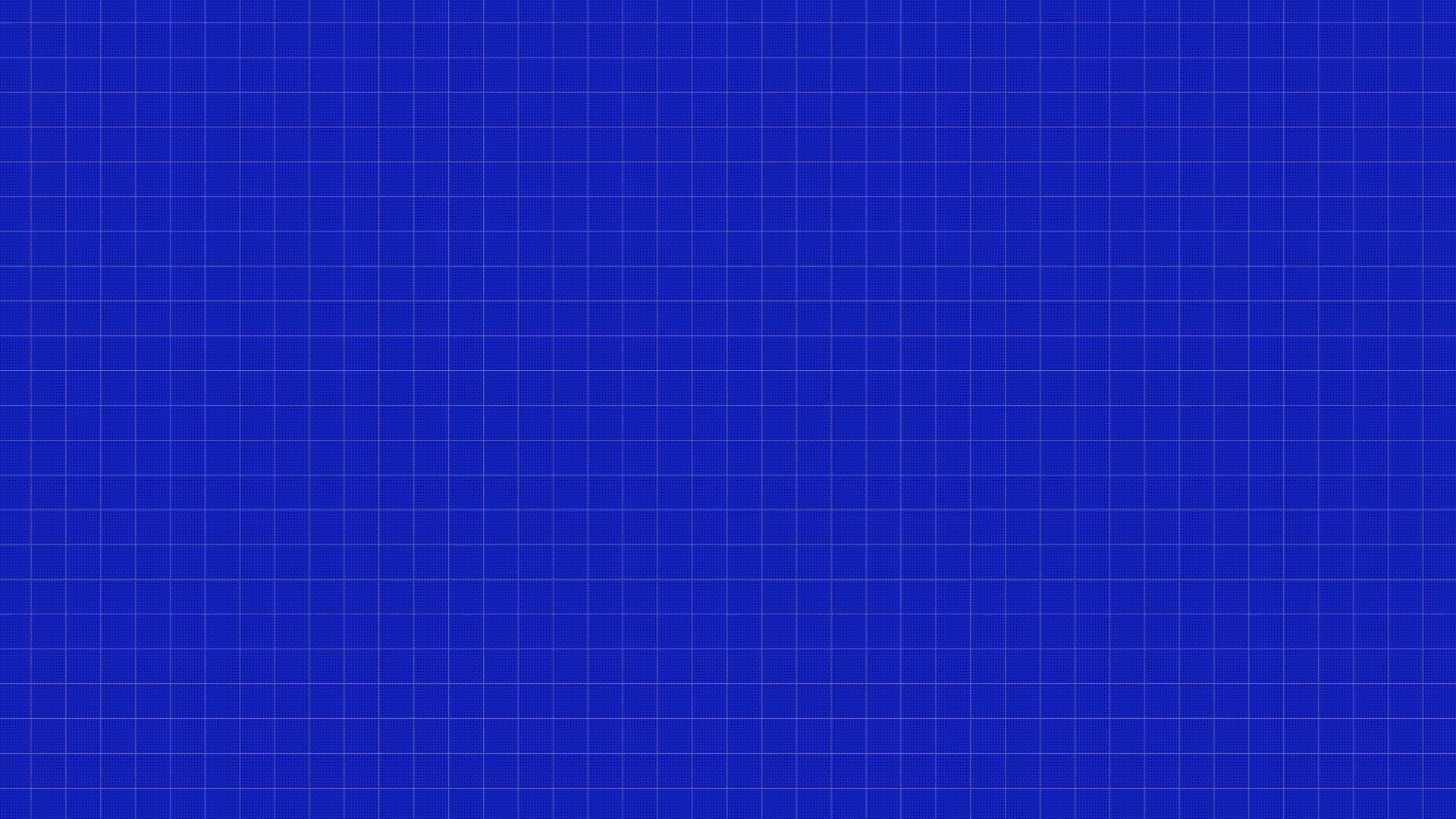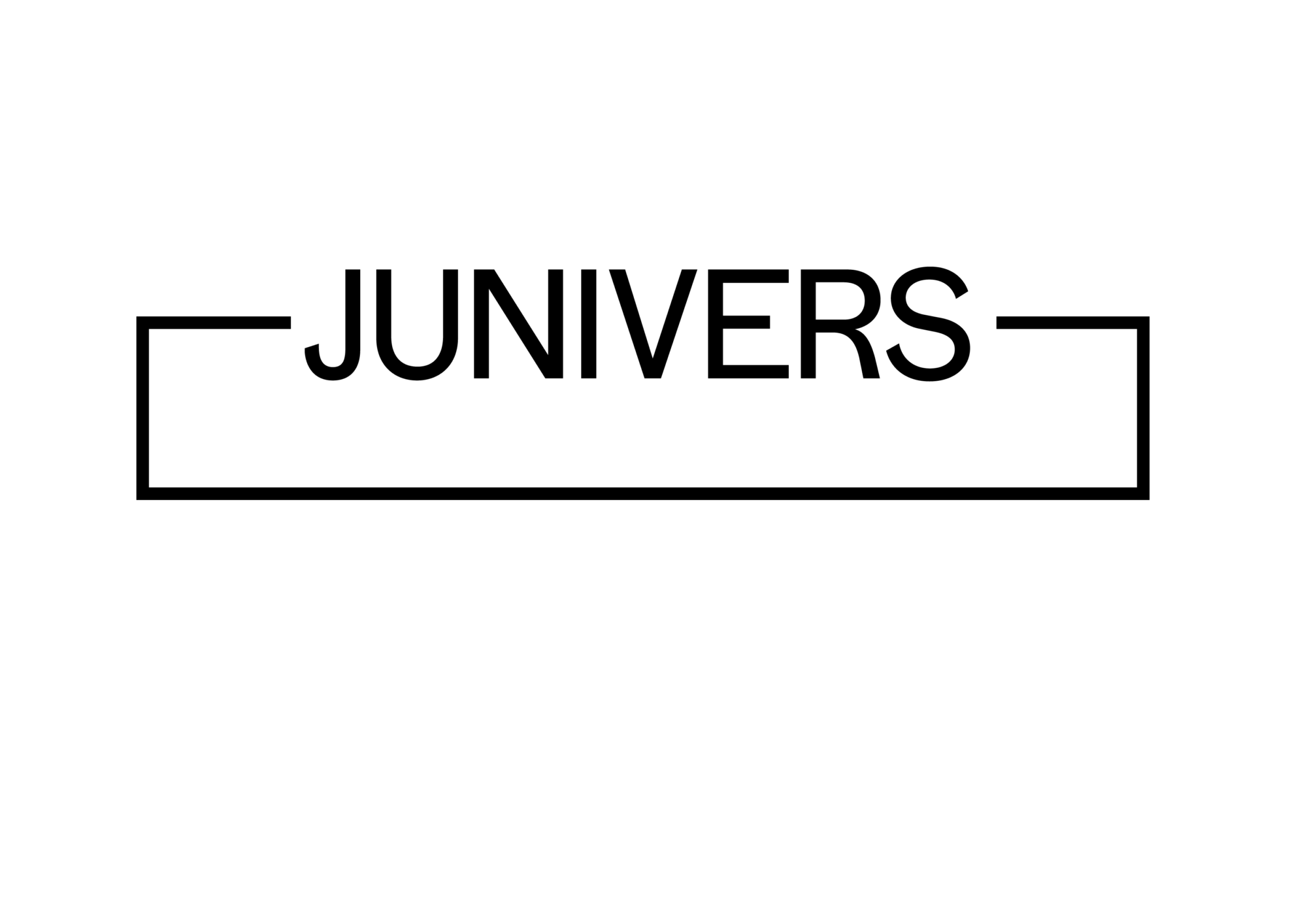Caroline Schmidt: »Dogs with too-long spines are uncomfortable to look at«
Dogs with too-long spines are uncomfortable to look at
Auszug
Aus dem Englischen von Julia Wolf
Hunde mit zu langem Rücken sind unangenehm anzusehen
Gestatten Sie mir einen Moment der Schwäche: Oh, wenn doch nur jemand anderes das hier für mich übernehmen könnte! Wenn ich nur die Augen schließen und an etwas Angenehmes denken könnte, irgendetwas leicht Unscharfes, wie ein Gemälde von Pierre Bonnard. Ein später Vormittag in Pastell-Tönen, ein Frühstückstisch mit einer karierten Tischdecke, darauf Brotkrümel, lila Schatten schweben darüber. Es muss Hochsommer sein, denn da steht eine Schüssel mit Kirschen. Über einem flaschengrün lackierten Stuhl ist eine gelbe Strickjacke drapiert und in der Tür sitzt ein Hund, eine Art Dackel, aber mit kürzerem Rücken, denn Hunde mit zu langem Rücken sind unangenehm anzusehen, und der Hund sitzt immerhin mit dem Rücken zu uns im Türrahmen. Er blickt den Flur entlang, als warte er auf jemanden und sein Rücken hat die perfekten Proportionen, im Verhältnis zum restlichen Körper generell, besonders aber im Verhältnis zu den Beinen. Neben diesem Hund würde ich ewig sitzen und, sollte er das mögen, seine Ohren streicheln, die weich wie Weidenkätzchen sind – wenn nur die Person, auf die er wartet, ins Nebenzimmer gegangen ist, um dort auf Sie zu treffen, mit Ihnen in Plüschsesseln oder irgendwelchen anderen Stühlen ihrer Wahl Platz zu nehmen und Ihnen zu erklären, was nach meiner Ankunft bei William List passierte. Wenn Sie gestatten, lege ich die Füße hoch, ich schließe die Augen und stelle mir Szenen wie diese vor, während jemand, der weniger mit der ganzen Sache zu tun hat als ich, sich einschaltet und Ihnen alles erzählt …
Marthe spricht
Oh, Moment mal! Ich war gerade dabei, mir ein Bad einzulassen – nein, warten Sie, gehen Sie nicht, ich habe nur einen Scherz gemacht. Sie haben sicher die Gerüchte über meine Waschgewohnheiten gehört. Was gewisse Leute unter Wissenschaft verstehen, also wirklich. Ich fürchte, die Geschichte hat es nicht gut mit mir gemeint. Nun ja, wenigstens habe ich mein Leben genossen. Habe ich wirklich, wissen Sie. Trotz allem. Und doch wurmt es mich: Wie immer weiter unerwünschte Beobachtungen zu meiner Figur angestellt werden, meinen Stimmungen. Es ist einfach zu viel. „Obwohl sie schon Mitte fünfzig war, stellte der Künstler sie als junge Frau dar”. Sprach die Tate, vor nicht allzu langer Zeit. Was wissen die schon über meine Figur mit Mitte Fünfzig? Was wissen die über Zeit? Stimmt schon, wenn Pierre mich ansah, schob sich immer ein Geist meines früheren Ichs zwischen uns. Doch das war keine Maske – das war vielmehr ein Schlüssel, der es ihm ermöglichte, mich in der vierten Dimension zu sehen. Und außerdem verschleiert Wasser vieles; im Wasser ist schließlich die Schwerkraft aufgehoben. Das weiß doch jedes Kind. Womit wir auch schon beim eigentlichen Problem wären: Kinder. Wir hatten keine. Daher die Obsession mit meiner „Gesundheit”, meinem Körper. Vielleicht wollen sie wissen, ob ich unfruchtbar bin. Aber dieses Wort hat Dornen, nicht? Stopfen wir es dahin zurück, wo es herkam.
Ich fürchte, von dieser Unterhaltung wird mir ganz warm – wollen wir nicht in den Garten hinausgehen? Doch erst reichen Sie mir mal Ihren Arm, ich will meine Strumpfhosen ausziehen. Es ist so ein wunderschönes Gefühl, mit nackten Beinen im weichen Frühlingsgras zu sitzen. Wir können uns im Schatten der Kastanie etwas hinlegen. Die Architektur der Menschen ist nichts dagegen. Sehen Sie die Blüten? Opulent, nicht? Wie die Flammen an einem riesigen Armleuchter. Ihre Schönheit währt so viel länger als die der Blumen am Boden, weil sie dort oben am Himmel niemand hinterfragt. Aber irgendwann hängen sie dann auch schlapp wie Seidenstrümpfe da. Blatt für Blatt fallen sie wie Konfetti herunter, und selbst, wenn sie verwelken und beige werden, haben sie immer noch die Pracht von sich auflösender Spitze. Sehen Sie nur hier, mein lila Flieder. Obwohl es schon Anfang Juni war, stellte der Künstler ihn dar, als wäre es noch Mai. Kommen Sie, bewundern sie meinen Flieder. Fast blau, wie? Nun schließen Sie mal die Augen und stellen Sie sich den Geruch vor. Hat Ihre Nase gerade etwas gezuckt, sagen Sie schon? Pierre und ich spielen immer solche Spiele, jetzt, da wir tot sind.
Oh, wie schön, dass sich endlich jemand für meine Geschichte interessiert. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Marthe. Ich bin 1881 zur Welt gekommen, in – sagen wir einfach irgendwo im Süden von Paris. Was haben Sie gesagt? Oh. Sie sind gar nicht meinetwegen hier. Sie interessieren sich für … sie? Aber sie ist so gewöhnlich. Ja, natürlich weiß ich, was geschah – ich bin tot, ich weiß alles. Nach dem Tod gibt’s nicht mehr viel, was sich zu wissen lohnt. Also schön. Wie heißt sie gleich wieder? Agnes? In Ordnung. Ich habe ohnehin nichts Besseres zu tun. Auch wenn es eine Schande ist. Ich hätte ihnen gerne von Monsieur Renard erzählt. Aber lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich lege mich hier ins hohe Gras und spiele die Stellvertreterin. Aber vorher kommen Sie her und bewundern meinen Flieder…
Sinneswandel
Marthe hat sich dann doch geweigert, meine Geschichte zu erzählen. Klagte über Kopfschmerzen und einem Krampf in der Wade, und warf mich aus ihrer Küche. Das war, nachdem sie mir vorgeworfen hatte, dass es mir an Autonomie mangele. „Die Konstruktion ist doch ziemlich wirr, findest du nicht?”, sagte sie. „Sei nicht albern – sprich mit deiner eigenen Stimme! Damit meine ich, die Stimme, mit der du früher gesprochen hast.” Dann fing es draußen auch noch zu regnen an, und auch wenn es Marthe nichts ausmacht, nass zu werden, stinkt doch bei Regen ihr ganzer Garten nach Katzenpisse. Sie ist sich nicht sicher, ob es die Bäume sind, oder das Gras.
Sie griff nach einem Kristallkrug, der wie ein riesiger, ausgegrabener Granat aussah, und schenkte sich ein Glas Limonade ein. Sie trank das ganze Glas in großen Schlucken leer, bevor sie es wieder auf die hölzerne Anrichte stellte. Wenn du gehst, sagte sie und wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab, wobei auf einer Seite ihres flaumigen Schnurbarts winzige Perlen Limonade zurückblieben, nimm das hier mit. Meinen Anfangssatz:
Er wollte sie ganz, aber nicht unbedingt für sich selbst.
Er
„Meine Freunde nennen mich Billy”, sagte er, als er mir die Hand gab, und das war ein Angebot, das ich zwar nicht annehmen, aber auch nicht gänzlich ausschlagen wollte. Diese seltsame Andeutung, wir könnten Freunde sein, dabei hatten wir uns ja gerade erst kennengelernt. Mir war noch schwindelig von der Überfahrt. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch es kam nichts. Nur die knarrenden Schreie des Reihers waren zu hören, das Rauschen des Windes in den Pinien und das Wasser, das gegen das Ufer schlug. Vielleicht war es ja auch gar keine Einladung gewesen, sondern eine Feststellung. Und so tat ich von diesem Moment an alles, was in meiner Macht stand, um ihn nicht mit seinem Namen anzusprechen – mein erster erfolgloser Versuch, William auf Distanz zu halten. Denn natürlich erreichte ich damit genau das Gegenteil, ich schuf eine gewisse Vertrautheit zwischen uns – wenn ich mit mir selbst rede, benutze ich ja auch nicht meinen Namen, sondern immer nur das Pronomen du. So wurde aus William du. Irgendwann hörten wir ganz auf, miteinander zu reden, und auch wenn ich einen ungewöhnlichen Preis für diese Stille zahlte, war sie doch wie eine Droge, die mich zu mir selbst zurückführte, und ich hätte alles getan, um an diese Droge zu gelangen, wirklich alles.
William schien mir ständig irgendetwas zu geben und in seiner Gegenwart fühlte ich mich, als müsste ich immer alles annehmen, selbst die Dinge, die ich gar nicht wollte. Und im Gegenzug gab ich ihm selbst alles, worum er bat, alles, was ich zu geben hatte, und doch schien es mir, als hätte ich ihm nichts oder nicht genug zu geben, wenngleich ich mir dann wiederum sicher war, so sicher, dass ich ihm alles gab und ganz offensichtlich nichts, aber auch gar nichts, für mich selbst übrigblieb.
Nie zuvor hatte ich eine so seltsame Mischung aus Neugier und Abneigung erlebt wie an dem Tag, an dem wir uns kennenlernten. Das war der Beginn unseres kleinen Tanzes, dieses großen Akts der Verleugnung, der mich so ganz und gar erschöpfte. Nichts ist anstrengender als an sich selbst festhalten zu müssen. Bitte zwingen Sie mich nicht, Ihnen das zu erklären.
Wenn William List eins war, dann außerordentlich überzeugend. Nur wenige Stunden nach meiner Ankunft auf der Insel St. Claire begann er seine Überzeugungskünste auch auf mich anzuwenden. Noch heute werde ich unruhig, wenn ich daran denke. Ich werde zapplig. Mich überkommt das Verlangen, von meinem Schreibtisch aufzustehen. Nach nur wenigen Stunden auf der Insel erkannte ich, dass ich nie nach Mind zurückkehren würde, doch obwohl William auf so hartnäckige Art gastfreundlich war, wusste ich auch, dass ich bei ihm nicht bleiben konnte – aber jetzt rede ich schon von meiner Abreise, dabei sind wir noch gar nicht richtig angekommen.
Caroline Schmidt wurde in Princeton geboren. Nach einem Studium der Bildenden Kunst und einem Abschluss in Anglistik, zog sie 2014 nach Berlin, um an der Freien Universität Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft zu studieren. Sie arbeitet als Autorin und freie Übersetzerin von kunstgeschichtlichen und literarischen Texten. 2020 wurde ihre Übersetzung von Esther Kinskys Roman »Grove« (»Hain«) für den Oxford-Weidenfeld Translation Prize nominiert.