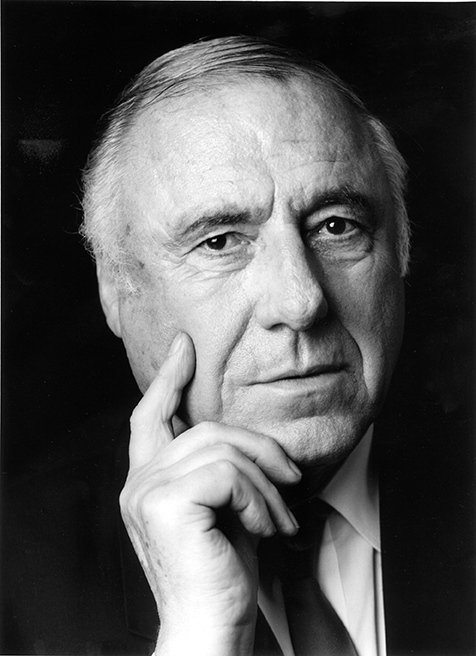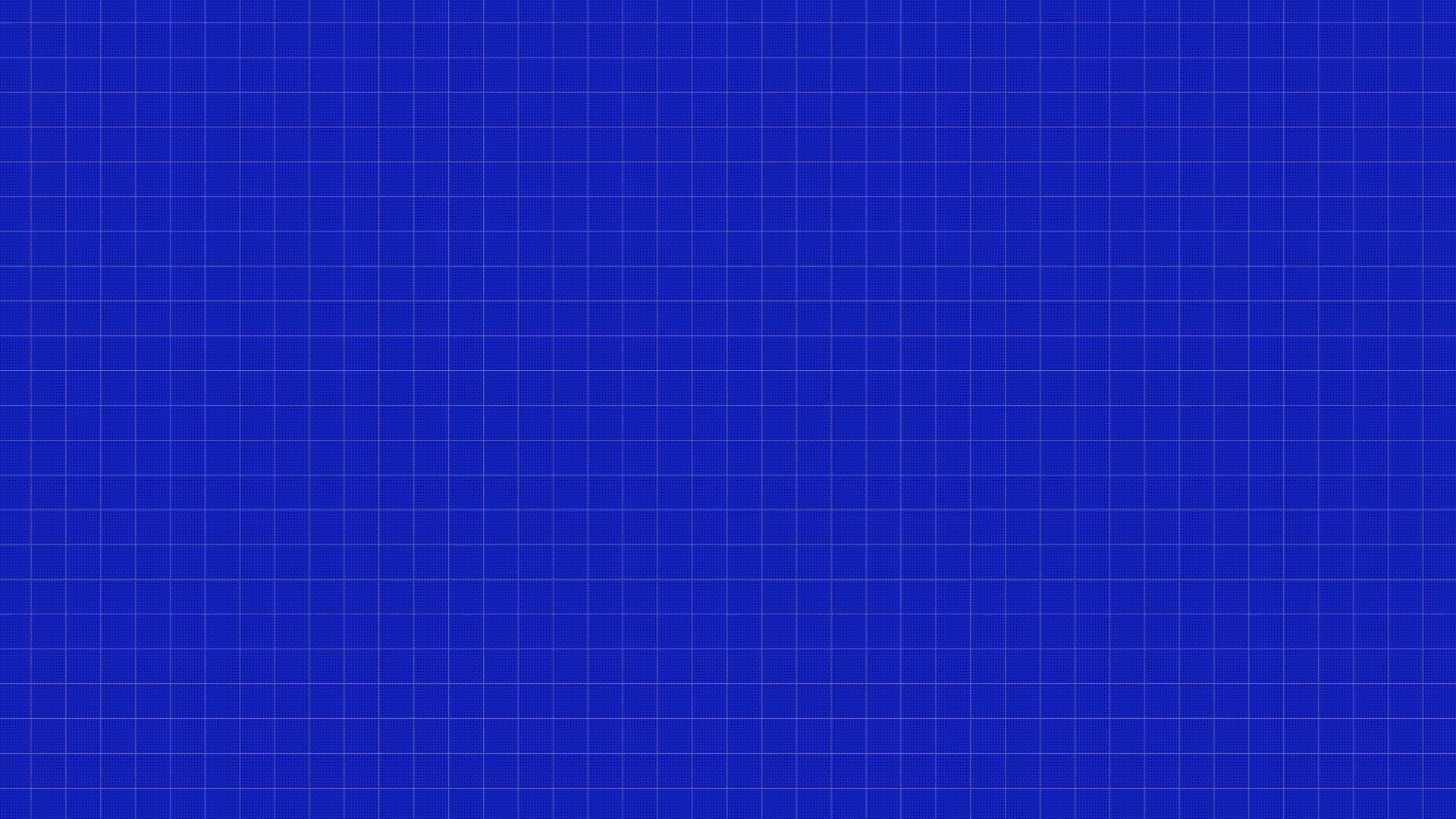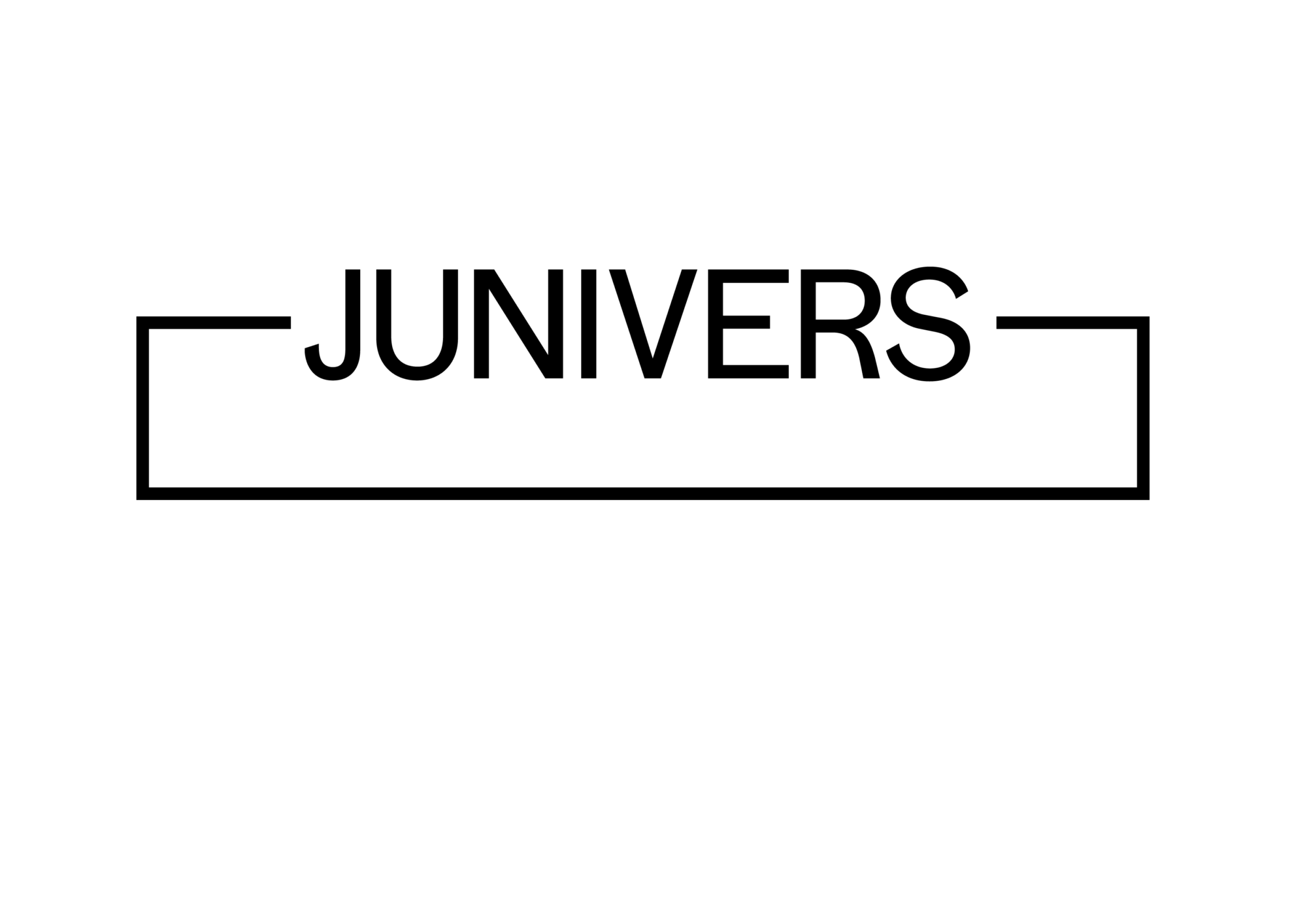Lann Hornscheidt: Respektvoll dichter dran am Lesen
Gestern, beim Abendessen mit Nachbar*innen, habe ich G gefragt, wie ihr der Roman gefallen habe, den ich ihr geliehen hatte über den Sommer. Es ist Shida Bazyars ‚Drei Kameradinnen‘. G erzählte mir aufgebracht, dass sie sich schrecklich aufgeregt habe über ‚den Besuch‘ und den Roman immer wieder weglegen musste, da sie so erzürnt darüber war, so angegriffen zu werden von ‚dem Besuch‘. „Sie könne ja nun nichts dafür“, gipfelte die Empörung meines Gegenübers, „in Thüringen geboren worden zu sein!“ Ich habe einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass ‚der Besuch‘ keine Situation meinte, sondern eine Figur im Roman, Saya. Saya ist eine der dem Roman seinen Titel gebenden „Drei Kameradinnen“. Im Spektrum der drei weiblichen Hauptfiguren des Romans (Hani, Kasih und Saya), ist sie diejenige, die politisch vielleicht die schärfsten und am stärksten frustrierten und am meisten desillusionierten Ansichten zu der Frage vertritt, wie in der weiß dominierten deutschen Gesellschaft überlebt werden kann, wie mit migrantistischer Diskriminierung umzugehen sei. Saya, eine nur indirekt durch die Ich-Erzählerin wiedergegebene Stimme, war offenbar weitgehend die einzige, die G lesend wahrgenommen – und die sie offenbar als zwischenmenschliche Anklage gelesen hat.
Für mich war das Spektrum möglicher Umgangsweisen mit dem das Leben durchziehenden Migrantismus der drei nebeneinander gestellten Figuren eine aufschlussreiche Ausdifferenzierung des Umgangsspektrums mit allgegenwärtiger sexistischer und migrantistischer Gewalt. Der Roman zeigt für mich neben vielem anderen auf, wie unterschiedlich Reaktionen auf lebenslang erlebte strukturelle Gewalt sein können. Mir persönlich als in Bezug auf Migrantismus privilegierter Person hilft er spüren zu können, wie ich emotional auf diese verschiedenen Umgangsweisen reagiere: was mich mitfühlend macht, was mich aufregt, ungeduldig macht, besorgt…
Keine unserer beiden Lese-Re_Aktionen ist besser als die andere, keine legitimer, keine objektiver, neutraler, allgemeingültiger.
Ich glaube: Es gibt nicht das neutrale und richtige Lesen eines Textes. Es gibt nicht das wirkliche Herauslesen der Intention der schreibenden Person. Genauso wenig, wie es ein neutrales, objektives oder allgemeingültiges Schreiben gibt, auch nicht von fiktiven Texten.
Dass Schreiben positioniert, d.h. in Abhängigkeit von Diskriminierungsstrukturen und der Position der schreibenden Person dazu ist, ist ja bereits eine jahrzehntealte Diskussion, auch in Bezug auf Literatur. Positionierung wurde und wird leider immer noch vor allem für Diskriminierte diskutiert – so ist es erst wenig her, dass in einer öffentlichen Diskussion zu einer Erzählung die Autorin gefragt wurde, wieso sie denn einen männlichen Ich-Erzähler gewählt habe und ob sie sich überhaupt in diese Position hineinversetzen könnte. Andersherum – ob Männer sich in weiblichen Figuren hineinversetzen könnten, wird diese Frage sehr viel seltener gestellt. Was auch daran liegen mag, dass privilegierte Personen – in diesem Falle also Männer – nicht als positioniert wahrgenommen werden, sondern als allgemeinmenschlich. Neutral. Und ihre Literatur ebenso als allgemeine Literatur.
Zu Fragen des positionierten Übersetzens gab es ja im auslaufenden Jahr hinlänglich Diskussionen, die an die niederländische Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht zur Inauguration des neuen us.amerikanischen Präsidenten andockten. Im Vorwort zur deutschen Ausgabe von Octavia Butlers Roman Kindred schreiben die Übersetzerin Mirjam Nünning und die Projektbegleiterin Sharon Dodua Otoo schon 5 Jahre vor der Gorman-Übersetzungs-Diskussion im deutschsprachigen Raum, also 2016:
„Alle Bücher sind positioniert: Das heißt, auch wenn dies nicht explizit benannt wird, werden Bücher aus einer bestimmten sozialen Position geschrieben und mit einem bestimmten sozial positionierten Publikum als Zielgruppe. Bücher werden ebenso positioniert übersetzt, auch wiederum mit einem bestimmten Zielpublikum. Dies fällt in der Regel nicht auf, da es sich meist um die privilegierteste Gruppe in der Gesellschaft handelt, die dann zudem noch als allgemeinmenschlich aufgefasst oder erklärt wird uns sich auch selbst so versteht und so verstehen kann.
Bei dem hier verwendeten Ansatz bieten wir allen lesenden Personen die Möglichkeit an, sich selbst in Bezug auf den Roman zu positionieren. Lesende, die in Bezug auf Rassismus privilegiert sind, sind hiermit explizit herausgefordert, positioniert zu lesen und insbesondere vorzulesen. […] Unsere Empfehlung wäre, vor dem Vor_Lesen einleitend darauf hinzuweisen, dass das N-Wort aus Respekt nicht vorgelesen wird, sondern an den entsprechenden Stellen durch „N*“, eine Sprechpause oder ein Handzeichen markiert wird. Wir sind der Meinung, dass es möglich und sogar notwendig ist, eine menschliche, empathische Haltung rassismuserfahrenen Personen gegenüber beim Vor_Lesen einzunehmen. Wir regen alle dazu an, genau dies anzustreben.“
Aufbauend auf diesen Diskussionen im allgemeineren und dem gestrigen Abendessen im speziellen glaube ich also, dass die Wahrnehmung von Schreiben und Übersetzen als positionierte Handlungen auch auf das Lesen oder Hören von literarischen Texten übertragbar ist. Dies ist auf einer Ebene schon immer eine wichtige Strategie diskriminierter Personen gewesen: Wie kann ich Texte so lesen, dass sie mich nicht ausschließen, mich nicht zuschreiben, mich nicht monsterisieren? Wie kann ich also im Lesen eine eigene widerständige Praxis leben? Wie kann ich zwischen den Zeilen lesen, die manchmal so hermetisch heteronormativ, weiß, nicht-behindert wie selbstverständlich ein Universum malen, wo nichts anderes denkbar ist.
Kann ich die Personen neu benennen? Kann ich Gewaltsituationen skandalisieren, wenn sie normalisiert sind im Text und nicht als Gewalt kenntlich gemacht werden? Kurzum: Kann ich mir also hegemoniale Literatur widerständig aneignen?
Dazu gibt es viele verschiedene Strategien, die Diskriminierte, so glaube ich, schon immer angewendet haben.
Auf einer weiteren Ebene leitet sich für mich hier gleichzeitig ein Modell positionierten Lesens ab. Ein sich bewusst machen, dass Lesen keine neutrale Handlung ist, sondern auf der Folie eigener Positionierung und Welterfahrung in Kontakt geht mit im Text angebotenen Positionierungen und Welterfahrungen. Mein konkretes Lese-Erleben und -Empfinden sagt demgestalt mehr über mich aus als über den Text selbst: Über mein mich in Bezug-Setzen zum Text, über meine Offenheit Neues kennenzulernen, mich herausfordern zu lassen; vielleicht sogar, mich kritisieren zu lassen, wie es der Roman von Shida Bazyar für weiße Personen durchaus anbietet. Kritisieren im allerbesten, lernenden und öffnenden Sinne natürlich.
Positioniertes Lesen könnte also bedeuten, sich bewusst über dieses komplexe Verhältnis im Klaren zu werden und es als Folie und Brille des eigenen Lesens begreifen zu können.
Positioniert zu lesen würde eröffnen, sich darüber Gedanken zu machen, welche Stimmen ich lesend wahrnehme, was ich hören kann und will. Ein wichtiger Teil davon ist es auch, darüber nachzudenken, wie ich Gelesenes einordne, einsortiere und auf diese Weise schon vor dem Lesen einen Referenzrahmen für mein Lesen schaffe, der mein offenes Zuhören vielleicht einschränkt. Ist Shida Bazyars Roman Migrationsliteratur – weil die Autorin einen familiären Migrationshintergrund besitzt und die Protagonistinnen ebenfalls? Ist es ’neue deutsche Literatur‘, weil die Autorin nicht älter als 40 Jahre ist, ‚Frauenliteratur‘, weil sie weiblich sozialisiert ist und sich so versteht und die Geschichte um drei Frauengestalten kreist. Und stelle ich dieselben Fragen an alle Romane und alle Autor*innen?
Meiner Möglichkeit lesend mich einem literarischen Text zu öffnen ist dabei natürlich mitbestimmt von einigen strukturellen Eckpunkten: Was kann ich überhaupt lesen? Was bekommt überhaupt den Status eines publizierten Werkes, rezensiert, mit Preisen versehen, meine Aufmerksamkeit auf sich ziehend, wird in Literaturhäuser eingeladen, gefeiert und zerrissen, bekommt einen Raum in Hörräumen?
Für Diskriminierte kann Lesen von Literatur überlebenswichtig sein: um sich abzulenken. Sich zu amüsieren. Aber auch, um sich ein stückweit ausgedrückt zu finden in Wörtern, Erzählungen, Bildern, an die sie anknüpfen können mit ihrem eigenen wortlosen oder nicht wortbar scheinenden gewaltkonstituierten Erleben. Literatur kann eine Erweiterung der eigenen Wahrnehmung dazu bieten, wie strukturelle Gewalt sich im individuellen Leben umsetzt – sowohl als fortdauernde Gewalt als auch als unterschiedliche Weisen des Widerstandes dagegen. Um auf diese Weise die isolierende und schambesetzte Individualisierung gewaltvollen Lebens kurz, beim Lesen, einmal aufheben zu können.
Was ist mit all den Leerstellen in diesen Lese- und Hörräumen, die ja auch durch das Projekt, welches wir mit der Veranstaltung heute feiern, implizit aufgerufen werden? Wo sind die Leseräume zu heterosexueller Literatur, statisierter Literatur (also der Literatur ohne biografischen oder inhaltlichen Migrationshintergrund); durch Rassismus und Genderismus umfassend privilegierter Literatur (also von weißen Cis-Männern)? Diese Literatur, so ließe sich argumentieren, nimmt ja bereits das ganze Literaturschloss ein und braucht keine Extraräume. Die Extraräume, die wir hier feiern, sind notwendig, um den diskriminierten Positionen Gewicht und Raum zu verleihen. Das Problem an dieser Raumordnung ist aber eben, dass das Schloss als normal und neutral bestehen bleibt in seiner grandiosen Erhabenheit und der Großteil der nicht spezifisch nach Herkunft, sexuellen Vorlieben und regionalen Zuordnungen einsortierten Räume als einfach nur ‚Literatur-Räume‘ ebenso. Die so umfassend privilegierte Literatur wird nur sehr selten als positionierte – eben privilegierte – Literatur gelesen, nur selten besprochen als partikulare Erzählung einer nicht allgemeinmenschlichen Geschichte, sondern als durch umfassende Privilegierung mitbestimmten Welt- und Menschensicht: einer weißen heterosexuellen, nicht-behinderten, cis-männlichen Erzählwirklichkeit inklusive der Projektionen auf andere Positionen.
Während die Literatur Diskriminierter die diskriminierenden Strukturen in ihren individuellen Auswirkungen fast immer auch zum Thema hat, denn es ist die einzige Wirklichkeit, die da ist, ist privilegierte Literatur sehr häufig unsensibel für genau diese Privilegierung, die das eigene Erzählen aber ganz genauso stark mitbestimmt.
Diese hegemoniale, in Bezug auf die eigene Gewaltverhältnis-Konstituierung unreflektierte Literatur hat mich, ganz ehrlich, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, schon immer gelangweilt. Noch mehr als gelangweilt, sie hat mich beschädigt in ihrem Gestus allgemeinmenschliches zu erzählen und damit und darin doch nur Gewalt zu normalisieren, so dass ich im Laufe meines literatur-fremdsozialisierten Lebens in Deutschunterrichten und Universitätskursen auch häufig damit haderte, meiner eigenen Wahrnehmung zu trauen.
Wie schwierig ist es beispielsweise, die in Literatur immer und immer wieder angebotenen heteronormativen Vorstellungen von Sexualität als Ausdruck von Liebe abzulegen – wenn sie so unglaublich beharrlich immer wieder aufgerufen werden?
Den queeren Hörraum mitzugestalten war für alles das – für das Suchen und Versuchen eines positionierten und respektvollen Hörens und Lesens – eine große Freude und Inspiration. Es war eine große Herausforderung und eine große Chance für mich.
Ich wünsche dem Projekt zu seinem Jubiläum den Mut, nicht nur Diskriminierten Perspektiven weitere kleine Räume zur Verfügung zu stellen, sondern ebenso wichtig – die privilegierten Perspektiven auf ihre kleinen Sonder-Räume zu verweisen und sie danach zu befragen, wie sie die eigene Privilegierung – in Sprachformen und Erzählmustern, in Setzungen in den Narrationen verarbeiten – und sie so aus der Illusion einer Allgemeinverständlichkeit, Allgemeinrelevanz und -gültigkeit und positioniert-befreiten Ästhetik herauszunehmen.
Dieser Essay wurde beim 10 Jahre Dichterlesen.net-Zoom am 15.10.21 in Breakout-Rooms vorgetragen.